Der Sufismus und die Frage nach einer neuen Vernunft
Obwohl weitgehend unerforscht, birgt der Sufismus einen kaum ausgeschöpften Reichtum an geistiger und kultureller Schöpferkraft. In Marokko bilden seine Werte und Ausdrucksformen weit mehr als ein spirituelles Erbe - sie sind ein lebendiges Paradigma, ein zivilisatorisches Gedächtnis, das bis heute kulturelle Identität und gesellschaftliche Kreativität inspiriert.
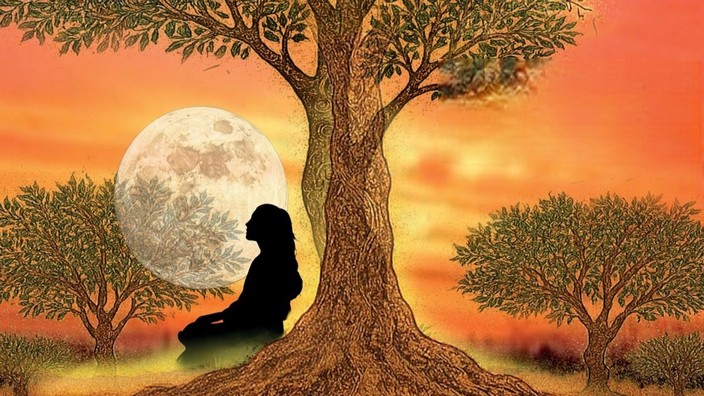
Wer sich von der Strahlkraft der Sufi-Tradition in Marokko überzeugen möchte, braucht nur einzutauchen in den unermesslichen Reichtum ihrer Dichtung und Überlieferung. Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis ist eines der ältesten Werke dieser geistigen Strömung: Einblicke in die Zeiten der Sufis von Ibn al-Zayyât al-Tâdilî - in einer meisterhaften kritischen Ausgabe neu herausgegeben von dem Historiker und Schriftsteller Ahmed Taoufiq. Dieses Werk öffnet nicht nur ein Fenster in eine versunkene Welt, sondern auch in die Tiefe einer spirituellen Denkweise, deren Aktualität sich dem wachen Geist bis heute offenbart.
Die Wissenschaft als spirituelle Herausforderung
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit der Entdeckung des Quantenuniversums und der Entfaltung einer weitgehend kontraintuitiven, fast schon rätselhaften mathematischen Sprache, durchlief das wissenschaftliche Weltbild eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Eine Revolution, die nicht nur die Physik erschütterte, sondern auch das Fundament unserer Erkenntnistheorie. Denn die einst unerschütterlich geglaubte Trennung zwischen Subjekt und Objekt verlor ihre Gültigkeit: Der Beobachter beeinflusst durch den bloßen Akt der Wahrnehmung das, was er beobachtet. Die Idee einer objektiven Außenwelt, die sich unabhängig von uns erklären ließe, musste einem neuen Verständnis weichen - einem, das die Welt nicht mehr jenseits unseres Bewusstseins verortet, sondern in ihm.
Vom Widerspruch zur Versöhnung: Glaube und Vernunft im Wandel
Der Zusammenstoß zwischen der muslimischen Welt und der westlichen Moderne hat im Laufe des späten 19. Jahrhunderts eine Reihe von geistigen Strömungen hervorgebracht, die gemeinhin unter dem Begriff Reformismus zusammengefasst werden. Als prägende Figuren dieses intellektuellen Aufbruchs gelten der Ägypter Muhammed Abduh (1849-1905) und der aus dem iranischen Asadabad stammende Jamâl ed Dîn al Afghânî (1838-1897). Beide suchten - auf je eigene Weise - nach Wegen, religiöses Denken mit den Herausforderungen der modernen Welt in Einklang zu bringen.
Ein Sinnbild für die Spannungen, die dieser Dialog freilegte, ist die berühmte Debatte zwischen al-Afghânî und dem französischen Philosophen Ernest Renan (1823-1892). Diese wurde angestoßen durch Renans Vortrag Islam und Wissenschaft, gehalten 1883 an der Sorbonne. Trotz ihrer weltanschaulichen Gegensätze einte beide Denker eine grundlegende Einsicht: Religion, so ihre gemeinsame Annahme, könne ein Hemmnis für die Entfaltung wissenschaftlicher Rationalität darstellen - ja, unter bestimmten Umständen sogar zu deren Unterdrückung beitragen.
Doch al-Afghânî ging über eine bloße Diagnose hinaus. Für ihn stellte sich die entscheidende Frage: Wie lässt sich religiöses Denken so reformieren, dass es nicht länger ein Hindernis, sondern ein Träger der Vernunftkraft wird? Wie lässt sich der Geist befreien - nicht durch Verwerfung der Tradition, sondern durch ihre innere Erneuerung? Es gehe, so lässt sich seine Position zusammenfassen, darum, unseren Verstand zum Spiegel seiner selbst zu machen, damit er im Licht der Selbstreflexion jenes Dunkel vertreibt, das die Unwissenheit über das eigene Wesen in uns wirft. Doch dieses Licht ist nicht das gleißende einer Sonne - es gleicht eher dem flackernden Schein einer Kerze, zart und verletzlich, und doch von ungeheurer Klarheit.
Wir werden uns hier nicht in die wechselvollen Schattierungen dieses Reformismus vertiefen, der zwischen dem Streben nach intellektueller Erneuerung und der Ausbildung von Ideologien oszillierte - Ideologien, die bald in politische Projekte mündeten, mal liberal gesinnt, mal extremistisch aufgeladen. Entscheidend ist: Das religiöse Denken jener Epoche sah sich einem Konzept von Rationalität gegenübergestellt, das selbst aus einem bestimmten Bild der Wissenschaft hervorging - jenem dominierenden Paradigma des 19. Jahrhunderts, das Wirklichkeit als objektiv mess- und erklärbar betrachtete.
Doch mit dem Eintritt ins 20. Jahrhundert begann sich dieses Bild tiefgreifend zu wandeln. Die Entdeckung der Quantenwelt und die Entwicklung einer eigenwilligen, oft kontraintuitiven mathematischen Sprache, die sie zu beschreiben versuchte, führten zu einer stillen, aber fundamentalen Revolution in unserem Denken. Mit ihr rückte ein erkenntnistheoretisches Moment ins Zentrum der Wissenschaft: Die klare Trennung zwischen Subjekt und Objekt, lange als unerschütterliches Fundament des Wissens geglaubt, begann zu bröckeln. Fortan galt: Jeder Beobachter beeinflusst durch seine bloße Wahrnehmung das, was er beobachtet. Eine von uns unabhängige Außenwelt - eine objektive Realität, die sich erklären ließe, ohne dass wir selbst Teil ihrer Erklärung wären - trat in den Hintergrund. Was bleibt, ist das Erleben des eigenen Bewusstseins - ein inneres Erkennen, das die Welt nicht länger von außen betrachtet, sondern sie in sich trägt.
Zu der Revolution im Denken, die die Quantenphysik im Innersten des Mikrokosmos ausgelöst hat, gesellt sich eine zweite - ebenso tiefgreifende - Umwälzung, diesmal auf der Ebene der Makrophysik. Sie verdankt sich dem belgischen Physiker Georges Edouard Lemaître (1894-1966), der als einer der ersten den kühnen Gedanken formulierte, dass das Universum weder statisch sei noch ewig in einem stationären Zustand verharre. Vielmehr befinde sich das All in einem fortwährenden Prozess der Ausdehnung - ein Gedanke, der Jahrzehnte später durch Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop eindrucksvoll bestätigt wurde. Demnach ist das Universum nicht von jeher, wie Aristoteles einst glaubte, sondern es hat eine Geschichte: eine rund 14 Milliarden Jahre währende Evolution von Energie, Materie und Struktur.
Diese beiden komplementären Visionen - die der Mikro- und die der Makrophysik - haben das wissenschaftliche Weltbild des 20. Jahrhunderts grundlegend erschüttert und neu geformt. Sie markieren nicht nur eine Verschiebung im Verständnis von Realität, sondern auch einen tiefgreifenden Wandel in unserem Verhältnis zu Wissenschaft und Rationalität. War im 19. Jahrhundert die Vernunft noch Gegenspielerin des Glaubens - letzterer galt vielen als das überkommene Erbe eines vormodernen Weltverständnisses, das der „Kult der Vernunft“, wie er sich seit der Französischen Revolution artikulierte, zu überwinden suchte -, so eröffnet das neue Paradigma vielmehr Möglichkeiten der Versöhnung. Glaube und Vernunft erscheinen nicht länger als Gegensätze, sondern als zwei Aspekte desselben menschlichen Strebens nach Wahrheit. Nichts in diesem erweiterten Denkmodell schließt ihre Komplementarität aus - im Gegenteil: Alles weist darauf hin, dass sie einander bereichern können.
Diese neue Auffassung von Rationalität, die sich nicht mehr als fertiges System versteht, sondern als ein sich stetig entwickelnder Prozess, hat weitreichende Konsequenzen für unser Denken und unser Weltverhältnis. Sie mündet - besonders im Westen - in das, was man gemeinhin als postmoderne Bewegungen bezeichnet: ein Bemühen, jene nüchterne Entzauberung der Welt zu überwinden, die Max Weber als Kennzeichen der Moderne beschrieben hatte. In einer Welt, die durch technische Vernunft erklärt, aber nicht mehr gedeutet wird, wächst die Sehnsucht nach einem tieferen Sinn - einem Zusammenhang, der über das rein Messbare hinausreicht.
Spiritualität als Erkenntniskraft: Der Sufismus im Zentrum
Wenn jedoch das Bewusstsein - wie die moderne Physik nahelegt - eine aktive Rolle bei der Konstitution der Wirklichkeit spielt, dann kann auch Spiritualität nicht länger als bloß subjektive Regung oder als äußere Betrachtung abgetan werden. Vielmehr wird sie zum notwendigen Teil einer umfassenden Weltdeutung - einer, die metaphysische, physische und soziale Dimensionen miteinander zu verbinden sucht. Spiritualität wird damit nicht zur Flucht aus der Wirklichkeit, sondern zu einem Versuch, sie in ihrer Tiefe zu artikulieren, zu durchdringen, ja zu verwandeln.
Diese Haltung lässt sich in vielen Bereichen unserer Gegenwart erkennen. Einer der klarsten Stimmen in diesem Zusammenhang war der französische Agrarökologe Pierre Rabhi, der in seinem Denken immer wieder auf die ökologische Zerstörung unserer Welt verwies - und darauf bestand, dass es ohne eine Revolution des Gewissens keine wirkliche Veränderung geben könne. Nicht technischer Fortschritt allein, sondern eine innere Wandlung des Menschen müsse im Zentrum jeder Hoffnung auf Erneuerung stehen.
Im Islam ist es der Sufismus, der jene innere Wissenschaft verkörpert - nicht im Sinne empirischer Überprüfbarkeit, wohl aber als Erfahrung der Vertiefung und Verfeinerung des Bewusstseins. Es ist eine Schule der Seele, ein Weg, der nicht allein dem Denken, sondern vor allem dem Erleben verpflichtet ist. Anders als die ersten Reformer der Moderne, die sich oft dem Rationalismus verschrieben, suchten andere muslimische Denker nach einem Weg, der über die auf Vernunft reduzierte Rationalität hinausführt. Sie fragten nicht nur, was sich erklären lässt, sondern was sich geistig durchdringen, was existenziell bezeugen lässt - und welchen Beitrag ein spirituell durchdrungenes Denken für die Gegenwart leisten kann.
Eine globale Vision des Geistes: Vom Sufi-Erbe zur universellen Ethik
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts treten in diesem Geiste Gestalten wie der indopakistanische Dichter-Philosoph Mohammed Iqbal (1877-1938) hervor, dessen Denken die muslimische Welt bis heute tief beeinflusst. Oder der marokkanische Philosoph Taha Abderrahman (geb. 1944), der mit beeindruckender Klarheit eine ethisch-spirituelle Vernunfttheorie entwickelt hat, die das islamische Erbe neu zur Geltung bringt. Und auch der senegalesische Philosoph Soleymane Bachir Diagne (geb. 1955) bereichert diesen Diskurs mit einer bemerkenswerten Verbindung aus afrikanischem Denken, westlicher Philosophie und islamischer Spiritualität.
Dieses geistige Mosaik ließe sich erweitern durch zwei herausragende Persönlichkeiten, deren Werke bleibende Spuren hinterlassen haben: der algerische Emir Abdekader (1808-1883), nicht nur als Freiheitskämpfer, sondern auch als Mystiker und Humanist, insbesondere durch sein eindrucksvolles „Schreiben an die Franzosen“, das wie ein Aufruf zu universeller Ethik und interkulturellem Respekt gelesen werden kann; und Amadou Hampâté Bâ (1901-1991), der große malische Anthropologe, Geschichtenerzähler und Sufi, der wie kaum ein anderer die spirituelle Weisheit Afrikas in den Dialog mit der Moderne brachte.
Von größter Bedeutung ist es heute, diese Gedanken, Erfahrungen und Vermächtnisse zusammenzuführen - nicht im Sinne einer Rückkehr in die Vergangenheit, sondern als Impulsgeber für eine erkenntnistheoretische Erneuerung des Gewissens. Es ginge darum, ein Denken zu begründen, das Spiritualität und Humanismus nicht trennt, sondern in fruchtbare Beziehung zueinander setzt. Ein Denken, das sich dem Universellen öffnet, ohne seine kulturellen Wurzeln zu verleugnen - vielmehr sie wiederentdeckt, gerade in der Tiefe der Sufi-Tradition, die im Islam über Jahrhunderte hinweg als Quelle innerer Verfeinerung und transzendenter Einsicht gewirkt hat.
Solch ein Ansatz überschreitet kulturelle Grenzen. Er verbindet sich mit anderen Wegen der Weisheit, anderen spirituellen Horizonten - östlichen wie westlichen, indigenen wie modernen. In ihrer jeweiligen Einzigartigkeit können sie gemeinsam an einem neuen Prozess mitwirken: an einem geistigen Erwachen, das nicht abstrakt bleibt, sondern konkrete gesellschaftliche Projekte inspiriert - Projekte, die einer neuen Vorstellung von Menschlichkeit, Miteinander und Sinn Raum geben. In dieser Vielstimmigkeit könnte eine neue Welt entstehen - nicht als Utopie, sondern als Vision, die im Innersten der Herzen beginnt.
Infos über Faouzi Skali* finden Sie hier
Übersetzung aus dem Französischen
_______________
Die Redaktion:
Der Sufismus lehrt uns, Spiritualität nicht als Flucht vor der Welt, sondern als schöpferische Kraft des Bewusstseins zu verstehen - als einen Weg der inneren Verfeinerung, der Selbstreflexion und der ethischen Orientierung. Inmitten einer Zeit, die von technischem Fortschritt und äußerer Veränderung geprägt ist, erinnert er uns daran, dass wahre Erneuerung aus der Tiefe des menschlichen Herzens erwächst.
Wenn wir die jahrhundertealten Weisheiten des Sufismus mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft und den vielfältigen spirituellen Traditionen der Welt verweben, eröffnet sich ein neuer Horizont des Denkens - ein Denken, das Grenzen überschreitet, Brücken baut und Wege zu einem achtsameren, verbundenen Miteinander weist.